Von der Konfrontation zur Kooperation
Der Prozess der Versöhnung in den deutsch-dänischen Beziehungen im 20. Jahrhundert
3. bis 9. August 2025

Die deutsch-dänische Grenzregion hat sich in den vergangenen 100 Jahren grundlegend verändert: Von einem umstrittenen Landstrich zwischen zwei ungleichen Nachbarn zu einer Modellregion für nationale Minderheiten und ein friedliches Zusammenleben. Die 1920 durch Referenda festgelegte Grenze blieb lange Zeit umstritten, sowohl in den nationalen Minderheiten als auch in der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung.
Die Sommeruniversität untersucht Hintergründe und aktuelle Herausforderungen der Nachbarschaft im Norden. 1945, die »Stunde Null« der deutsch-dänischen Beziehungen, stellt den Ausgangspunkt des Seminars dar. Im Rahmen der NATO und der europäischen Zusammenarbeit entstand ein vertrauensvolles Miteinander der beiden Länder.
Die Sommeruniversität ’25 konzentriert sich zudem auf die Situation der in der deutsch-dänischen Grenzregion lebenden Minderheiten, die in der Zwischenkriegszeit politisch und gesellschaftlich benachteiligt waren, heute aber eine besondere Funktion als europäische Brückenbauer haben.
Am Beispiel der deutsch-dänischen Grenzregion wird der Prozess der Versöhnung zwischen Dänemark und Deutschland thematisiert. Insbesondere wird danach gefragt, ob die Aufweichung nationalstaatlicher Grenzen zu einer Transnationalisierung der zwischenstaatlichen Versöhnung geführt hat.

Ein interkultureller Lernort
Die Sommerschule beleuchtet die unterschiedlichen nationalen Narrative, besucht regionale Gedenkstätten und diskutiert die Bedeutung von nationalen Minderheiten für die heutige Gesellschaft. Die Teilnehmer:innen werden in Kleingruppen verschiedene Podcasts erstellen, um sowohl die spezifischen Geschichten als auch ihre Verwendung zu verstehen und zu vermitteln. Hier erhalten sie die Möglichkeit, mit individuellen Perspektiven auf Geschichte, Kultur und Politik in einer multiethnischen Gesellschaft zu arbeiten.
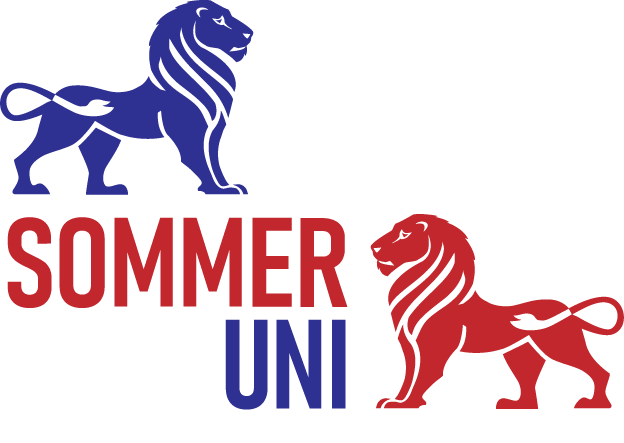
Internationale Teilnehmende und interdisziplinäre Forschung
Als Kooperationsveranstaltung des Internationalen Wirtschaftskommunikationsstudiums und des Zentrums für Grenzregionsstudien der Süddänischen Universität, des Instituts für Hessische Landesgeschichte der Philipps-Universität Marburg, der Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, des Friesischen Seminars und des Studiengangs European Cultures and Societies der Universität Flensburg, der Ausländerförderung der Konrad-Adenauer Stiftung, des Bundes Deutscher Nordschleswiger und der Dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig, richtet sich die Sommeruniversität an Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen.

Der internationale und interdisziplinäre Zuschnitt ermöglicht es den Teilnehmenden, die Entwicklung einer historischen Grenzregion aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren. Dadurch eröffnet sich für Studierende wie Dozenten zugleich ein neuer Blickwinkel auf die Geschichte und Gegenwart in der deutsch-dänischen Grenzregion. Die Sommeruniversität stellt somit einen innovativen Studien- und Begegnungsort dar, der den fachlichen, interdisziplinären und interkulturellen Austausch bewusst fördert. Arbeitssprachen der Sommeruniversität sind Deutsch und Englisch.

Beteiligte Institutionen
